Die Gesamtheit der Bodentiere wird als
Bodenfauna bezeichnet. Sie
setzt sich aus verschiedenen Tierarten zusammen, die sich
durch eine geringe Körpergröße auszeichnen
und im Wesentlichen folgenden Gruppen angehören: Einzeller
(Protozoen), Fadenwürmer (Nematoden),
Weichtiere (Mollusken), Ringelwürmer (Anneliden)
und Gliederfüßer (Arthropoden). Daneben
kommen auch einige Wirbeltierarten im Boden vor
(s. Systematische Gruppen).
Hinsichtlich ihrer Körpergröße
wird die Bodenfauna in 4 Gruppen untergliedert (s. Grafik):
| Mikrofauna: |
Körperdurchmesser < 0,2 mm
Arten: Einzeller und kleine Fadenwürmer |
| Mesofauna: |
Körperdurchmesser 0,2-2 mm
Arten: Rädertiere, Fadenwürmer, Strudelwürmer,
Milben, Springschwänze |
| Makrofauna: |
Körperdurchmesser 2-20 mm
Arten: Enchyträen, Regenwürmer, Schnecken, Spinnen,
Asseln, Tausendfüßer, Insekten und Insektenlarven
verschiedener Ordnungen |
| Megafauna: |
Körperdurchmesser > 20 mm
Arten: verschiedene Wirbeltierarten, z.B. Lurche, Reptilien,
Insektenfresser (u.a. Maulwurf, Spitzmäuse), Nagetiere
(u.a. Mäuse) |
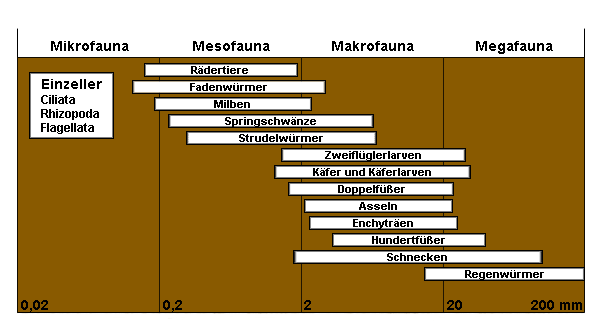 |
Einteilung der wichtigsten Bodentiergruppen
nach Größenklassen
(Abb.
verändert nach DUNGER 1983 und HINTERMAIER-ERHARD/
ZECH 1997, S. 39) |
Vertreter der Mikrofauna
sind deutlich häufiger im Boden anzutreffen als die der
Meso-, Makro- und Megafauna (s. Artenreichtum
und Formenvielfalt der Bodenorganismen (1) ). Ihre Aktivitätszonen
konzentrieren sich in der Regel auf die wasserführenden
Mittelporen (Mikroporen) und Wasserfilme der Bodenpartikel,
während die Mesofauna
die überwiegend luftgefüllten Grobporen (Bioporen)
besiedelt. Vertreter der Makro-
und Megafauna dagegen sind
in Lage, aktiv größere Hohlräume im Boden
zu graben (DUNGER 1998).
Allgemein nimmt die Anzahl der Individuen
einer Art im Bodenkörper mit abnehmender Körpergröße
der Art stark zu. Gemessen an der Anzahl der Individuen dominieren
in einem unbelasteten Boden Einzeller, gefolgt von Fadenwürmern,
Milben und Springschwänzen. Bezogen auf die Biomasse,
d.h. auf das Gewicht der Individuen pro Flächen- oder
Raumeinheit verschiebt sich diese Relation (s. Anzahl
und Biomasse der Bodenorganismen). Danach wird der Hauptanteil
der Biomasse der Fauna in normalen Böden von den Regenwürmern
mit 40 bzw. maximal 400 g pro m² Bodenoberfläche
(vgl. BRAUNS 1968, S. 63) gestellt.
Insgesamt beträgt der Anteil der Bodentiere
an der Gesamtmasse der Bodenorganismen (=Edaphon)
etwa
20 %, wobei der Anteil des Edaphon an der organischen Gesamtsubstanz
des Bodens durchschnittlich nur bei 5-7 % liegt (s. Grafik).
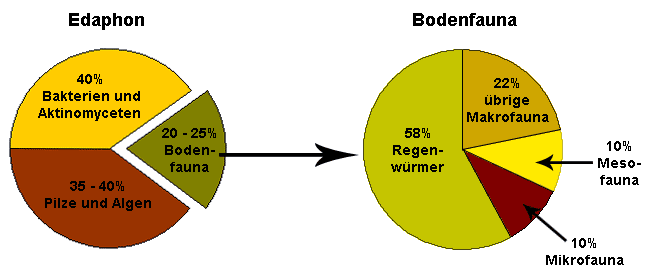 |
Mengenanteile der Bodenfauna
am Edaphon und Gewichtsanteile der verschiedenen Bodentiergruppen
(Abb. verändert nach DUNGER
1964, S. 10 und BRAUNS 1968, S. 61). |
Voraussetzung für ein reichhaltiges
Bodenleben und eine vielfältige Bodentierwelt ist ein
locker strukturierter Bodenkörper mit vielen Hohlräumen
(grobporenreiches Porenvolumen), ein ausreichender Gehalt
an abbaubaren Bestandsabfällen (Laubstreu) und ein ausgeglichenes
Bodenklima (Wärme, Feuchtigkeit und Durchlüftung).
Eine arten- und individuenreiche Gemeinschaft von Bodentieren
ihrerseits trägt zu einer permanenten Durchmischung des
Bodens und beschleunigten Streuabbaus bei, was die mikrobielle
Zersetzung der organischen Substanz
und Anreicherung des Mineralbodens mit Ton-Humus-Komplexen
fördert.

| Literatur |
| BRAUNS, A. (1968): Praktische
Bodenbiologie. Stuttgart: G. Fischer. |
| DUNGER, W. (1964): Tiere im Boden.
Wittenberg: A. Ziemsen. |
| DUNGER, W. (1983): Tiere im Boden
- 3. Auflage - Wittenberg: A. Ziemsen. |
| DUNGER, W. (1998): Böden
und Bodentiere als wechselseitiges Bedingungsgefüge.
In: Sächsische Akademie für Natur und Umwelt
in der Sächsischen Landesstiftung Natur und Umwelt
(Hrsg.) : Der Schutz des Bodens als gemeinsame Aufgabe
von Bodenschutz und Naturschutz. Dresden, S. 71-78. |
| GISI, U./ SCHENKER, R./ SCHULIN,
R./ STADELMANN, F.X./ STICHER, H. (1997): Bodenökologie
- 2. Auflage - .Stuttgart; New York: Thieme. |
| HINTERMAIER-ERHARD, G./ ZECH,
W. (1997): Wörterbuch der Bodenkunde. Stuttgart:
Enke. |
| RÖMBKE, J./ BECK, L./ FÖRSTER,
B./ FRÜND, H.-C./ HORAK, F./ RUF, A./ ROSCICZWESKI,
C./ SCHEURIG, M./ WOAS, S. (1996): Boden als Lebensraum
für Bodenorganismen - Literaturstudie - Im Auftrag
des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch die
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg,
Karlsruhe. www.uvm.baden-wuerttemberg.de/bofaweb/berichte/tbb04/tbbo4.htm
(Stand: 15.9.02). |
| SCHEFFER, F./ SCHACHTSCHABEL,
P. (2002): Lehrbuch der Bodenkunde - 15. Auflage -. Heidelberg;
Berlin: Spektrum Akademischer Verlag. |
|