Bodenkrümel, Hohlräume und Gänge verschiedener
Größe und Struktur differenzieren den Lebensraum Boden zunächst
einmal in zahlreiche Mikrosphären und Nischen mit unterschiedlichen
physikalisch-chemischen Lebensbedingungen. Mit zunehmender
Bodentiefe sind diese Bedingungen im Wesentlichen durch Sauerstoffmangel,
Lichtmangel und hohe Bodenfeuchtigkeit gekennzeichnet.
Für die Besiedlung der Pedosphäre
als Lebensraum spielt die Raumstruktur des Bodenkörpers eine
große Rolle, insbesondere die Größe und Häufigkeit der Hohlräume
bzw. Bodenporen , die mit
Luft und bzw. oder Wasser gefüllt sind. Der gesamte Bodenkörper
wird zwischen den festen Bodenkrümeln von einem labyrinthartigen
Porensystem durchzogen. Der Durchmesser der Poren nimmt in
der Regel mit zunehmender Bodentiefe ab und reduziert sich
von wenigen Millimetern auf Bruchteile davon. Parallel dazu
nimmt der Feuchtigkeitsgehalt und Kapillarwasseranteil zu.
Ein durchschnittlich entwickelter Bodenkörper
besteht etwa zur Hälfte aus fester Substanz, die sich zu Bodenkrümeln
zusammenlagert, und zur Hälfte aus Hohlräumen bzw. Bodenporen.
Ungefähr ein Drittel dieser Poren ist großvolumig und mit
Luft gefüllt und zwei Drittel sind kapillarwasserführend.
(s. Porenvolumen)
Bodenlebewesen besiedeln die Bodenporen
und Oberflächen der Bodenpartikel. Sie können sich über
das Porensystem weiter ausbreiten und dadurch das Porensystem
auch verändern. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Wurzelwachstum
der Pflanzen, das den Boden auflockert und neue Siedlungsräume
schafft.
Aufgrund der geringen Porengröße sind
die meisten Bodenlebewesen sehr klein und an die spezifischen
Verhältnisse - Lichtarmut, Sauerstoffmangel und hohe Feuchtigkeit
- besonders angepasst. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt im
organisch angereicherten Oberboden.
Die Verteilung der verschiedenen Organismenarten
im Boden ist abhängig vom Durchmesser der Bodenporen.
So können Feinporen mit einem Durchmesser < 0,2 µm
nicht besiedelt werden. Aufgrund ihrer geringen Größe
und ihrer besonderen Stoffwechseleigenschaften können
alle Bakterienarten die Mittelporen (Durchmesser 0,2 - 50
µm ) bewohnen, auch wenn die Poren längerfristig
wassergefüllt sind. Steht ausreichend Sauerstoff zu Verfügung,
können die Mittelporen auch von vielen Pilzarten, Algen,
Einzellern (Protozoen) und Wurzeln besiedelt werden. Die mehrzelligen
Bodentierarten dagegen sind so groß, dass sie nur die
Grobporen (Durchmesser > 50 µm) bewohnen können,
die in durchlässigen Böden in der Regel nicht mit
Wasser gefüllt sind.
Neben diesen bodenphysikalischen Strukturmerkmalen
wirken sich weitere spezifische Eigenschaften des Bodenkörpers
wie z.B. Bodenklima, Mineralsalzgehalt und Bodenreaktion (s.
Bodeneigenschaften) auf die Lebensbedingungen
im Boden aus. Die Gesamtheit der Einflüsse, die von der
unbelebten Umwelt auf die Lebewesen (im Boden) einwirken,
werden als abiotische Faktoren
bezeichnet.
Darüber hinaus werden die Lebensbedingungen
im Boden durch biotische Faktoren
differenziert, d.h. durch Einflüsse, die von den Lebewesen
selbst ausgehen. Dazu gehören z.B. Konkurrenzwirkungen
zwischen Artgenossen und zwischen Vertretern verschiedener
Arten, Räuber-Beute-Beziehungen, symbiotische und parasitische
Lebensformen und Nahrungsketten bzw. -netze (s. Interaktionen
und Nahrungskette und Nahrungsnetze im Boden).
Diese wirken sich wiederum modifizierend auf die abiotischen
Faktoren aus.
Die Qualität der abiotischen und biotischen
Faktoren des Lebensraumes beeinflusst die Zusammensetzung
der Arten in einer Lebensgemeinschaft
und ihre jeweilige Individuendichte. Abiotische und biotische
Faktoren, die an einem Standort wirksam sind, werden daher
auch als Standortfaktoren bezeichnet und je nach Ursprung
differenziert in natürliche
Standortfaktoren und anthropogene,
d.h. durch menschliche Tätigkeit bedingte Standortfaktoren
(z.B. Eintrag von Luftschadstoffen, Düngung, Bodennutzung).
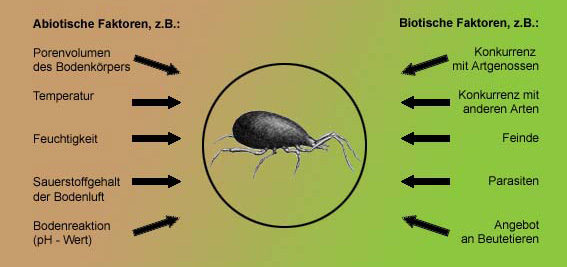 |
Abiotische und biotische Faktoren,
die am natürlichen Standort auf ein Lebewesen - hier:
Raubmilbe - einwirken können.
(Abb. verändert nach TOPP 1981, S. 15; Zeichnung:
Karen Kiffe) |
Weitere Informationen:
| Literatur: |
| BRAUNS, A. (1968): Praktische
Bodenbiologie. Stuttgart: G. Fischer. |
| DUNGER, W. (1964): Tiere im Boden.
Wittenberg: A. Ziemsen. |
| GISI, U./ SCHENKER, R./ STADELMANN,
F.X./ STICHER, H. (1997): Bodenökologie. 2. Auflage. Stuttgart;
New York: Thieme |
| TOPP, W. (1981): Biologie der
Bodenorganismen. Heidelberg: Quelle & Meyer. |
|